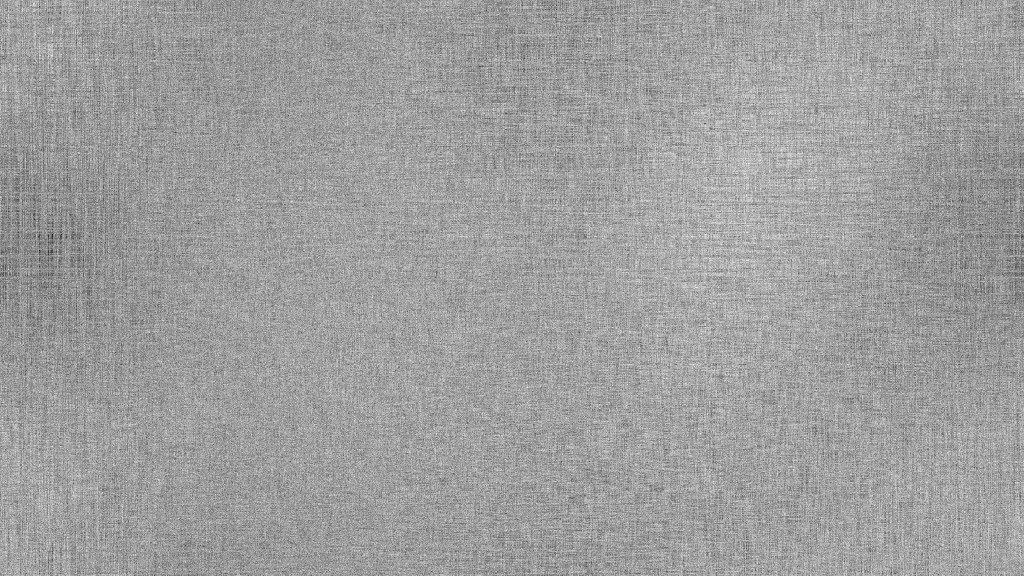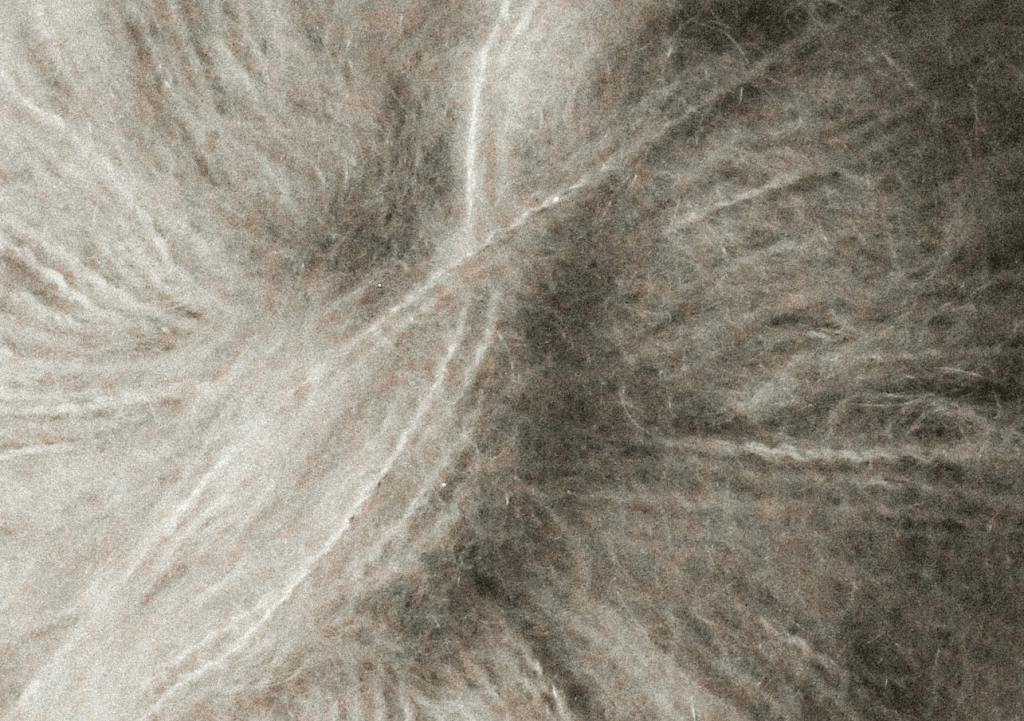Ich scrolle durch Videos einer Frau, die deutlich älter ist als ich und doch aussieht, als hätte sie den Körper und das Gesicht einer sehr viel Jüngeren. Glatte Haut. Definierte Arme. Disziplin bis in die letzte Pore. Eine halbe Million Menschen schauen ihr dabei zu. Die Erklärung folgt zuverlässig: viel Schlaf, viel Wasser, Sport, bewusste Ernährung. Keine großen Geheimnisse. Eigentlich ganz einfach. Wirklich?
Die Frau, von der hier die Rede ist, gehört zu einer neuen Sorte von „Vorbildern“ auf Instagram. Ich setze das Wort „Vorbild“ an dieser Stelle bewusst in Anführungszeichen, weil ein Vorbild für mich mehr mitbringen sollte als einen clicky Insta-Hook. Diese Frauen schmücken sich mit Schlagwörtern wie „authentisch“, „ehrlich“ und „ganz natürlich“. Sie schlafen viel, trinken Wasser, schwören auf natürliches Botox, essen clean und sehen dadurch mit Mitte 50 angeblich aus wie Mitte 20. Wenn das stimmen würde, was diese Frauen uns verkaufen wollen, müssten Schlaf und Bananenschalen gegen Falten inzwischen ein erfolgreicheres Anti-Aging-Mittel sein als jede Schönheitsklinik zwischen Hamburg und München. Tja. Ehrlichkeit verkauft sich eben einfach nicht so gut wie eine gut inszenierte Lüge.
Altern als Frage der Haltung
Über eine riesige Followerschaft hinweg wird die Idee verkauft, Altern sei im Grunde eine Frage von Disziplin. Wer es richtig macht, bleibt glatt, straff, faltenfrei. Wer es nicht schafft – na ja, offenbar selbst schuld. Das Problem daran ist nicht, dass eine Frau mit 56 gut aussehen und attraktiv bleiben will. Das Problem ist die Erzählung dahinter. Dieses hartnäckige Märchen vom „Alles ganz natürlich“. Ein Satz, der mich schwer an die frühen 2000er erinnert. Als Models uns noch erzählen wollten, dass sie ihren Body und ihren Teint dem Trinken von Wasser und ihren Genen zu verdanken haben.
Es ist eine der erfolgreichsten Erzählungen unserer Gegenwart: Altern sei keine biologische Tatsache mehr, sondern eine Frage der Haltung. Wer ausreichend schläft, sich diszipliniert ernährt und regelmäßig Sport treibt, könne dem Lauf der Zeit nicht nur trotzen, sondern ihn gewissermaßen umkehren. In den sozialen Netzwerken wird diese Idee millionenfach verbreitet. Besonders wirksam ist sie dort, wo sie von Frauen jenseits der fünfzig verkörpert wird, die aussehen, als hätten sie die Zeit nicht nur angehalten, sondern übersprungen. Die Botschaft lautet: Seht her, es ist möglich, ich bin der lebende Beweis! Das ist natürlich völliger Blödsinn. Und das wissen diese neuen „Vorbilder“ ganz genau.
Ich sehe so aus, weil ich es mir leisten kann“ verkauft sich einfach schlechter
Was bei diesem ganzen Jugendwahn konsequent ausgeblendet wird? Geld. Viel Geld. Und das, was man sich mit Geld eben so alles kaufen kann, um so auszusehen: Treatments, Eingriffe, Arztbesuche, Personal Trainer, kosmetische Dauerbetreuung, Produkte. Dinge, über die nicht gesprochen wird, weil sie nicht ins Narrativ passen. Denn „Ich sehe so aus, weil ich es mir leisten kann“ verkauft sich einfach schlechter als „Dieses Make-up lässt mich rückwärts altern“, „Natural Botox“ oder „Meinen straffen Teint habe ich Bananenschalen zu verdanken“. Spoiler: Nein. Diese Dinge machen das ganz sicher nicht. Sonst wären die Dermatolog:innen und Schönheitschirurg:innen in Deutschland ganz schön arm, oder?
Und dann wäre da noch das Thema Essen, bei dem ich fast einen Schreikrampf bekomme. Wenn Hüttenkäse mit Proteinpulver und ein paar Möhrchen als „Meal“ inszeniert wird, dann ist das kein gesunder Lifestyle, sondern eine sehr dünne – im wahrsten Sinne – Vorstellung davon. Vor allem für (junge) Frauen, die zusehen und denken: Ah, so sieht Kontrolle aus. So sieht Erfolg aus. So sieht Disziplin aus. Wenn ich das tue, dann kann auch so aussehen. Nein, auch das stimmt nicht. Es sieht nach krampfhaftem Verzicht aus. Nach Druck. Nach einem Körperbild, das mit „Balance“ ungefähr so viel zu tun hat wie Insta-Filter mit der Wirklichkeit. Uns wird genau das aber als normal verkauft. Und glaub mir: Das ist es nicht. Wenn du mit über 50 mehr auf deinen Körperfettanteil achtest als auf deine wahre Gesundheit und damit dann auch noch in den sozialen Medien prahlst, dass dein sichtlich untergewichtiger Körper quasi keine Fettpölsterchen an Bauch, Beinen & Co. hat, dann hast du ein wirklich ernsthaftes Problem. Und das lässt sich bestimmt nicht in irgendeiner fancy Praxis weglasern oder wegspritzen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wie eine Essstörung aussieht. Ich habe bereits seit meiner Jugend damit zu kämpfen.
Gefährlich wird es dort, wo Realität geleugnet wird
Was mir persönlich noch größere Sorgen bereitet ist dieser ständige Vergleich. 50‑plus wird an 26 gemessen – ein Maßstab, der weder biologisch noch logisch Sinn ergibt. Keine 65-Jährige sieht aus wie 26. Keine 65-Jährige wird je eine 26-Jährige sein. Nicht Optisch, nicht körperlich nicht mental und nicht psychisch. Egal, was sie dafür tut. Du siehst vielleicht etwas besser aus als der Durchschnitt. Herzlichen Glückwunsch. Die Realität lässt sich trotzdem nicht austricksen. Biologie ist kein Mindset. Altern ist kein persönliches Versagen. Und wer unbegrenzte Mittel in Optimierung steckt, sollte vielleicht nicht so tun, als hätte er gerade das Geheimnis des Lebens oder der Jugend entschlüsselt. Und genau dieser Vergleich, der permanent zwischen 56‑sein und 26‑aussehen‑wollen angesetzt wird, ist nicht inspirierend, er ist hochgradig toxisch. Es spielt keine Rolle, wie elegant man es „Balance“ oder „Bewusstsein“ nennt: Am Ende entsteht die Illusion, dass Alter nur eine Frage von Willenskraft sei. Dieses Narrativ reduziert ein ganzes Leben auf ein Schönheitsideal, das weniger mit Erfahrung, Kraft oder Persönlichkeit zu tun hat und mehr mit einem katalogisierten Körperstandard, bei dem junge Körper als universeller Maßstab gelten. Und alles, was davon abweicht, automatisch falsch, unzureichend oder zu alt und damit nicht begehrenswert erscheinen lässt. Age beautiful sieht für mich jedenfalls anders aus.
Was in dieser Debatte oft unterschlagen wird, ist der ökonomische Aspekt. Jugend ist heute kein Zufall mehr, sondern ein Markt. Wer über entsprechende Ressourcen verfügt, kann sie verlängern, glätten, modellieren. Das ist kein Geheimnis und auch kein Skandal. Skandalös wird es erst dort, wo diese Realität geleugnet wird. Oder, um es einmal auf den Punkt zu bringen: Wenn ich mir OPs, Laser, Skinbooster, Shots, Trainer und tägliche Treatments leisten könnte – ja, Überraschung! – würde man mir mein Alter vermutlich auch weniger ansehen. Kris Jenner weiß, wovon ich spreche. Hast du dich schon mal gefragt, warum diese Frau mit 70 (!) aussieht, wie sie aussieht? Nun, Cremes, Seren, LSF und Wasser werden dafür wohl kaum gesorgt haben, sondern vielmehr erfahrene Hände, Tools und Treatments. Von innen und von außen.
56 ist nicht 26!
Neidisch bin ich übrigens nicht, auch wenn das sicherlich einige beim Lesen dieses Textes behaupten werden. Es ist die moralische Überhöhung, die mich stört. Dieses unterschwellige: Ich bin so, weil ich alles richtig mache. Und du bist nicht so, weil du es eben nicht genug willst. Doch. Oder um es mit den Worten der meisten Menschen zu sagen: Es fehlt mir nicht an Willenskraft, nicht an Wissen und ganz sicher nicht an Disziplin. Es fehlt mir an finanziellen Mitteln, um mir all das leisten zu können, was du dir – und deinen 500.000 Follower:innen – als vollkommen natürlich verkaufst. Wer sich Optimierung in diesem Ausmaß leisten kann, sollte vielleicht weniger über Haltung sprechen und mehr über Voraussetzungen. Denn Moral lässt sich leicht predigen, wenn man sie sich kaufen kann. Was diese „Vorbild“-Frauen letztlich antreibt, kann ich nicht genau beantworten. Geht es um Anerkennung, um die permanente Bestätigung eines Publikums, das den eigenen Wert in Likes und Kommentaren misst? Um das Überspielen einer tief sitzenden Unsicherheit, die selbst mit perfekter Haut nicht verschwindet? Oder ist es schlicht die Aussicht auf Ruhm, Geld und Einfluss – auf ein Geschäftsmodell, das eine hollywoodreife Illusion verkauft? Vielleicht ist es von allem ein bisschen. Sicher ist nur: 56 ist nicht 26. Wer diesen Unterschied ständig weginszeniert, verkauft keine Inspiration, sondern eine Lüge – und nennt sie Disziplin.
Altern ist kein persönliches Versagen
Nicht nur die „Vorbilder“ selbst, auch Brands tragen übrigens eine große Verantwortung. Indem sie Menschen mit Millionen von Follower:innen eine Bühne geben, verkaufen sie nicht nur Produkte, sie verkaufen vor allem Bilder von scheinbarer Jugendlichkeit und makelloser Schönheit, die für die meisten unerreichbar sind. Nicht nur aus finanzieller, sonder vor allem aus realer Sicht. Die Konsequenz? Selbstzweifel, Essstörungen, ein verzerrtes Körperbild. Systematisch gefüttert von Algorithmen, die Perfektion und vermeintlich ewige Jugend belohnen, nicht aber Realität. Likes und Reichweite bestätigen einen Mythos, der suggeriert, jugendlich auszusehen und Erfolg zu haben sei allein eine Frage von Disziplin. Oder der richtigen Produkte. Während die finanziellen, körperlichen und technischen Voraussetzungen, die diese „Perfektion“ überhaupt erst möglich machen, verschwiegen werden.
Ich wünsche mir weniger Erklärungen darüber, wie man jung bleibt. Und mehr Ehrlichkeit darüber, was es kostet – und zwar körperlich, mental und finanziell. Mehr Transparenz über den Preis, den Optimierung fordert und über die Illusion, sie sei für alle gleichermaßen erreichbar. Vor allem aber wünsche ich mir mehr Gelassenheit. Die Erkenntnis, dass Altern kein persönliches Versagen ist und Jugend kein moralischer Verdienst. Falten sind kein Charaktermangel und ein weicher oder fülligerer Körper ist kein Zeichen von Schwäche. Meine persönliche Produktempfehlung an diese sogenannten ü50 „Vorbild“-Frauen? Ehrlichkeit. Die wäre bei diesem ganzen Age-Brainwashing-Zirkus definitiv das wirksamste Produkt von allen. Dumm nur, dass es dafür weder einen Affiliate-Link noch einen 15 %-Rabattcode gibt.